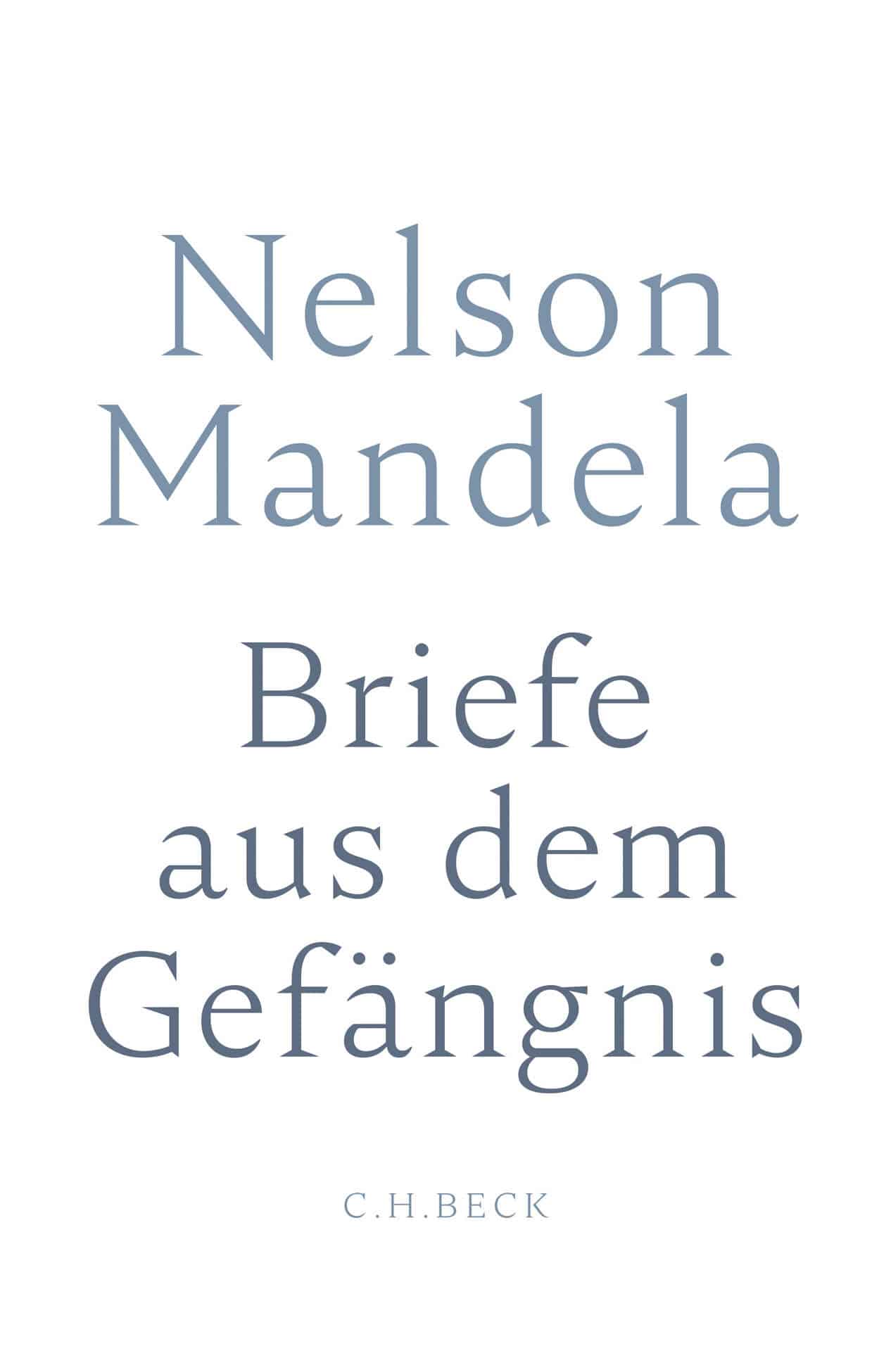Volker Reinhardt: Die Macht der Seuche. Wie die Große Pest die Welt veränderte 1347-1353. Verlag C.H. Beck, München 2021, 2. Aufl., Hardcover, 25 S/W-Abb. und 1 Karte, 256 S., ISBN 978 3 406 76729 6, € 24,00.
Unsere Kulturgeschichte zeigt, dass es keine absolute Sicherheit für das Dasein der Menschen gibt, denn «Katas trophen zerstören die Welt, Gefahren überschatten ihre Zukunft, und Risiken sind der Preis ihres Handelns», schreibt der Soziologe Wolfgang Sofsky in Das Prinzip Sicherheit (2005, S. 18).
Schon das Alte und Neue Testament erwähnen Heimsuchungen und Erkrankungen als «Geißeln der Menschheit», die heute als Infektionskrankheiten gedeutet werden. Die Historische Epidemiologie kennt zahlreiche Seuchenzüge; die wohl verheerendste Pandemie ist die «Große Pest», die zwischen 1347 und 1353 n. Chr. wütete. Sie raffte schätzungsweise 25 Mill. Menschen der damaligen europäischen Bevölkerung hin, mindestens jeder Vierte fiel dem «Schwarzen Tod» innerhalb weniger Stunden oder Tage zum Opfer.
Die Christen des Spätmittelalters sahen «Gottes Gericht» gekommen, da damals eine medizinische Ursachendiagnostik und Heilmittel fehlten. Vorannahmen und Vorurteile bestimmten das ohnmächtige Handeln der Zeitgenossen, um dem Tod zu entgehen. „Die causa remota, die höchste Ursache der Pest, wurde in der unheilbringenden Konstellation der Gestirne gesehen, von denen die todbringende Luft auf die Erde geschickt wurde“, (S. 31) schreibt der renommierte Historiker Volker Reinhardt (Univ. Fribourg, CH) in seinem fesselnden Geschichtspanorama zur Elementargewalt der «Pestilenz» und zum kollektiven und individuellen menschlichen Verhalten angesichts tödlicher Bedrohung.
Erst 1894 entdeckte der Schweizer Bakteriologe Alexandre Émile Jean Yersin (1863–1943) an Pestleichen in Hongkong den Pesterreger (Yersinia pestis) und die Ratte (Rattus rattus) als Wirt. Drei Jahre später identifizierten Masanori Ogata (1852–1919) und Paul-Louis Simond (1858–1947) das «jumping link» (S.31), den Pestfloh, als Vektor der Übertragungskette [s. hierzu ergänzend: die RKI-website https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/P/Pest/ Pest.html],
Heute, im «Zeitalter der degenerativen und gesellschaftlich verursachten Krankheiten» (sensu R. Spree 1992), wird von der breiten Öffentlichkeit verdrängt, dass ein Drittel aller Todesfälle auf Infektionen zurückzuführen ist. Die Pest gehört dabei zu den «vergessenen Krankheiten», da sie nur noch selten epidemisch aufflammt und mit Antibiotika gut behandelbar ist. Auch Pocken, Polio und Masern scheinen durch Impfungen besiegt, aber Infektiologen warnen seit Langem vor der pandemischen Ausbreitung gefährlicher Epidemien wie Ebola, Dengue und vor bislang unbekannten Supererregern, denn anthropozäne Veränderungen durch den Klimawandel und die Globalisierung bieten ideale Voraussetzungen für die Entstehung und Verbreitung großer Seuchen.
Mit dem Ausbruch der Covid-19-Epidemie in Wuhan (China) im Herbst 2019 bewahrheitete sich diese Befürchtung. Als das Virus SARS-CoV-2 nicht eingedämmt werden konnte und sich weltweit rasant verbreitete, erklärte die WHO am 11. März 2020 die Infektionskrankheit Covid-19 offiziell zu einer Pandemie, die die Weltbevölkerung bis heute in Atem hält und vor nie dagewesene Herausforderungen stellt.
Als exzellenter Kenner der Geschichte rekonstruiert Volker Reinhardt (*1954), wie die Große Pest von den Überlebenden wahrgenommen und bewältigt wurde. Seine „PestZeitreise“ (S. 14) baut auf einer kritischen Quellen- und Forschungsanalyse zeitgenössischer Berichte auf und wird zu einem besonderen Leseerlebnis, wenn die ferne spätmittelalterliche Vergangenheit mit der gegenwärtigen Corona-Pandemie verglichen wird und „in eine Fremdheit [führt], die immer wieder auch vertraut wirkt“ (S. 13). Einleitend geht es um Vergleichbarkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Pandemie-Zeiten. Gemeinsam ist den beiden Zoonosen die große Verunsicherung, denn Nichtwissen und Hilfslosigkeit verursachen Panik und Ängste, die individuelle und kollektive Verhaltensweisen verändern, insbesondere rationales Handeln. Beide «Seuchen» lösten „eine Atmosphäre des Misstrauens [aus], mit allem, was dazu gehört“, z.B. „Wuchern von Feindbildern, Aufkommen abstruser Verschwörungstheorien und eine Flut von Schuldzuweisungen“ (S. 10). Die Mediziner und Akteure der Politik mussten in beiden Fällen ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen, was durch „ostentativen Aktionismus“ (S. 10), durch Reglementierungen und Beschränkungen geschah, um Menschenleben zu retten. Wenn sich auch vieles gleichen mag, wie die allgemeine Verunsicherung und die Sehnsucht nach Normalität, so weist der Autor doch nachdrücklich darauf hin, dass die zeitspezifische „Andersartigkeit […] gebührenden Eingang finden [muss]“ (S. 13). Das gilt für das heutige schnelle Erkennen der medizinischen Ursachen und die wissenschaftlich fundierten Behandlungs- und Präventionsmöglichkeiten. Zu letzteren zählen insb. Impfungen, deren Erfolg Reinhardts Buch noch nicht berücksichtigen konnte. Der aktuelle Abruf der statistischen Werte des Bevölkerungsverlusts in Europa durch Covid-19 bei data4life.care.de (30.09.2021, 15:21h) liegt mit 1.289.711 Verstorbenen (= 1,94% der bestätigten Erkrankten) vergleichsweise niedrig, wobei die kalten Daten die dahinterstehenden Einzelschicksale die Todesängste und Qualen der Erkrankten und das Leid von Angehörigen, ausblenden.
Reinhardt beschreibt in meisterhaftem Erzählstil das Pestszenario in drei Hauptkapiteln, beginnend mit dem, was wir heute über die Herkunft, Ausbreitung, Krankheitssymp tome und Ursachen sowie die Fakten über Tote, Bevölkerungsverluste und Auswirkungen auf die Gesellschaft, Wirtschaft, Kirche und Kultur wissen. Dabei wird explizit die Quellenproblematik betont, die für die Geschichte der spätmittelalterlichen Pest viele Fragen offenlässt, z.B. wenn es um «Quantifizierungsversuche», «Zeitensprünge» und Erklärungsversuche für weitgehend von der Pest verschonte Regionen wie die Metropole Mailand, süddeutsche Handelsplätze oder Polen geht. Trotz vieler Datenlücken und offenbar dramatisierender Verfälschungen gelingt dem versierten Träger des Golo-Mann-Preises für Geschichtsschreibung eine kritische „Blütenlese neuerer Zahlenangaben“ (S. 35), die viele «Spitzendaten» als Legenden entlarvt. So wird die Auffassung von der Pest als dem «Großer Gleichmacher» korrigiert, da nachweislich „im Massensterben soziale Ungleichheit herrschte, denn die einfachen Leute starben durchweg häufiger als die Angehörigen der höheren Gesellschaftsschichten“ (S. 37). Im zweiten Hauptkapitel wird ausführlich thematisiert, wie die Menschen wichtigster europäischer Schauplätze dem Pestgeschehen entgegentraten. Als der Experte für die Geschichte Italiens legt der Autor den Fokus zunächst auf die italienischen Stadtstaaten Florenz, Rom, Mailand, Pisa und Venedig, um dann die Ereignisse in der „umstrittenen Stadt“ Avignon sowie dem «zusammenrückenden» Paris und in den Städten Würzburg, Straßburg und Frankfurt zu beleuchten, wo die Juden mit mörderischen Folgen zu Sündenböcken gemacht wurden und Flagellanten durch „massenhafte Selbstzerfleischung“ (S. 146) die Pest abzuwenden versuchten.
Reinhardts kritische Interpretation der «Pestberichte», die natürlich aus der Perspektive Überlebender verfasst wurden, sind gezeichnet von Motiven wie Verzweiflung, Hass, Ressentiments und Rachegelüsten bis hin zu Resignation und Ohnmachtsgefühlen, aber nur selten von Hoffnung auf bessere Zeiten getragen. Der verstörende Blick auf die dramatischen Prozesse zur Bewältigung des unfassbaren Geschehens zeigt politische Umstürze, wirtschaftliche Zusammenbrüche, religiöse Verwerfungen und künstlerische Umsetzungen.
Vieles bleibt „im Dunkel der Vergangenheit“, wie der Historiker festhält, was auch für das mailändische „Aussparungs-Wunder“ (S. 103) gilt, wonach es dem segnori Luchino Visconti durch rigorose Kontrollen der Güter, aber angeblich auch amoralische Isolierungsmaßnahmen bis hin zum „Einmauern“ gelang, die Pest erfolgreich abzuwenden. Dass der «Fall Mailand» in der Corona-Pandemie zu Tweets führte wie: „Gebt uns einen zweiten Luchino Visconti“ (S. 101), lässt aufhorchen, auf welch dünnem Eis unser moralisches und solidarisches Handeln in Krisenzeiten gründet.
Das dritte Hauptkapitel handelt von Menschen nach der Pest. Es berichtet streiflichtartig vom Aufstieg neuer Familien, von zuvor niemals erträumten politischen Karrieren, von plötzlichem Reichtum durch Erbschaften, von sozialen Umwälzungen und dem Autoritätsverlust der Institution Kirche sowie neuen künstlerischen Impulsen, was an Literaturbeispielen (u.a. F. Petrarca) und an (leider nur) s/w-Bildern illustriert wird.
Der Band endet mit einem geschliffenen Epilog, betitelt Alte Gewissheiten und neue Hoffnungen. Reinhardt konstatiert, dass der Wandel nach der Großen Pest „nicht als schroffer Abbruch oder kühner Aufbruch, sondern allmählich und gleitend […] oft erst mit beträchtlichem Zeitabstand tiefenscharf wahrgenommen wurde“ (S. 236). Auch von der gegenwärtigen Pandemie erwartet der Autor nicht „den von vielen Seiten beschworenen «Systemumbruch»“ (S. 240), sondern „dass nach Überwindung der CoronaPandemie der Wille zum Vergessen und zur Rückkehr in den vertrauten Rahmen überwältigend sein wird“ (S. 341); schließlich hat „noch keine Epidemie jemals eine neue «Epoche» eingeleitet“ (S. 325). Anderslautende Theorien bezeichnet Reinhardt als „intellektuelle Prunkrhetorik“ und mahnt deshalb zur Gelassenheit.
Fazit: Das wissenschaftlich fundierte Sachbuch reiht sich in die imposante Reihe überaus lehrreicher Geschichtsbücher des Autors ein. Es besticht nicht nur durch eine beeindruckend vielschichtige Retrospektive, sondern auch dadurch, dass die Covid-19-Pandemie vor dem historischen Hintergrund differenziert gespiegelt wird, ein erheblicher Mehrwert, den der Titel leider ausspart. (wh)
Andreas Eckert: Geschichte der Sklaverei. Von der Antike bis ins 21. Jahrhundert. C.H. Beck Verlag Wissen, München 2021, 128 Seiten, ISBN 978 3406 76539 1, € 9,95.
Welche Assoziationen verbinden Sie mit «Sklaverei»? Denken Sie zunächst an «Onkel Toms Hütte» (1852) von Harriet Beecher Stowe (1811–1896) oder Margret Mitchells (1900–1949) Welterfolg «Vom Winde verweht» (1936). Auszüge beider gehörten zu meiner schulischen Pflichtlektüre. Heute sind sie wohl wegen des «N»-Wortes vom Kanon verbannt. Vielleicht fällt Ihnen auch spontan der Monumentalfilm «Spartakus» (1960) mit Kirk Douglas als rebellierendem Gladiator ein oder die Familiensaga «Roots» (1976) von Alex Haley (1921–1992), die den Leidensweg des versklavten Gambiers Kunta Kinte schildert. Jüngere denken wohl eher an «Django Unchained» (1962), einen Kopfgeldjäger-Western mit Elementen des Blackploita tion-Genres. Welche Medien unsere jeweiligen Vorstellungen von Sklaverei auch immer geprägt haben mögen, das wahre Ausmaß dieses abscheulichsten aller Menschheitsverbrechen spiegeln sie nur ausschnittweise und klischeehaft wider.
Will man das schändliche Kontinuum «Sklaverei» von den Anfängen bis zur Gegenwart globalhistorisch verfolgen, kann man natürlich zu einem Handbuch greifen (s. Rez. zu Zeuske, M.: Handbuch der Sklaverei, 2 Bde. 2019, fachbuchjournal 2/2020, S. 26-28, wh), was vielen aber zu umfangreich sein mag, weshalb sich das vorliegende Taschenbuch von Andreas Eckert, Professor für die Geschichte Afrikas an der Humboldt-Universität zu Berlin, als kompakte Lektüre empfiehlt.
Einleitend entwirft Eckert ein „globales Panorama“ des ubiquitären Phänomens Sklaverei als „Institution, Handlungsmacht oder Prozess“ (S. 14). Vermutlich schon seit der Sesshaftwerdung, aber spätestens seit der Antike „steht fest, dass sich die «sehr alte Schlange Sklaverei» (M. Zeuske) zwar immer wieder gehäutet hat, aber nicht totzukriegen ist“ (S. 9).
Ziel des Sachbuchs ist der Versuch, sowohl „die Hybridität und Fluidität der Figur des Sklaven und seine jeweiligen Handlungsspielräume im historischen Kontext zu betrachten“, als auch darzulegen, „was Sklavenhändler und -halter dazu gebracht hat, solch grausame, gewalttätige und erniedrigende Situationen zu schaffen und aufrechtzuerhalten“ (S. 20). Es beschreibt die diachronen Praktiken der Versklavung aus soziologischer, rechtlicher, ökonomischer und politischer Perspektive, beginnend mit der griechischen Antike, in der Sklaven in jedem Haushalt eine «unhinterfragbare Normalität» waren (vgl. S. 22). Sklaverei dürfte in der Polis von den meisten Bürgern noch nicht einmal als Unrecht empfunden worden sein, wie aus der von Aristoteles dargelegten „Parallele zwischen Sklaven und domestizierten Tieren“ (S. 23) hervorgeht, denn Versklavung von «Barbaren» galt als Naturrecht. Ohne die Sklavenarbeit wären weder die athenische Demokratie noch das Römischen Reich existenzfähig gewesen. Zwar gab es in Hellas und Rom auch unterschiedliche Praktiken der Freilassung von Sklaven bzw. Manumission, aber da ihre Arbeitsleistung konstitutiv war, änderte selbst die Einführung des Christentums als Staatsreligion im Römischen Reich zahlenmäßig wenig (vgl. S. 29).
Im Mittelalter entwickelt sich durch den Einfluss der monotheistischen Religionen – Juden, Christen, Muslime – eine neue Dynamik. Da die Versklavung eigener Glaubensbrüder und -schwestern beschränkt oder ganz verboten wurde, „transformatierte sich das globale Netz der Sklavenhandelsrouten und Sklavenreservoirs“ (S. 31) und leitete einen Prozess der Diversifizierung der feudalistischen Ökonomien ein, für die Sklavenarbeit in unterschiedlichsten Funktionen essentiell war.
In den anschließenden Epochen geht es um die Zwangsmigrationen Versklavter aus Afrika, d.h. den transsaharischen Sklavenhandel, den in den Anrainerregionen des Indischen Ozeans sowie den transatlantischen und schließlich den im subsaharischen Afrika selbst (vgl. S. 36). Eckarts nüchtern-sachliche Beschreibung der Sklavensysteme in den unterschiedlichen Kulturkreisen lässt die verübte Gewalt der Sklavenjäger und -halter und die erlebten Qualen der verschleppten Männer, Frauen und Kinder nur erahnen. Allein die schieren Zahlen erschrecken, wenn im weniger bekannten regionalen Handelsnetzwerk des Indischen Ozeans „die Zahl der in diesem System versklavten Menschen den Umfang des transatlantischen Sklavenhandels übertraf“ (S. 43).
Eng verstaut, wie auf der Kreidelithographie des Covers illu striert, wurde die menschliche «Massenware» unter unermesslichen Torturen auf Sklavenschiffen verschifft und war bis in die nahe Neuzeit „ein Geschäft wie jedes andere, mit keinerlei moralischen Vorbehalten belastet“ (S. 49). Die Anzahl der unter tätiger Mithilfe afrikanischer Herrscher und Gesellschaften im 15.−19. Jahrhundert versklavten Schwarzen, die in die Plantagenökonomien der Neuen Welt verbracht wurden, wird auf 12 Millionen geschätzt, „wobei die wichtigste treibende Kraft der westeuropäische Kapitalismus“ war (S. 50). Sofern sie die Middle P assage überlebten, schufteten sie als Zwangsarbeiter auf Zuckerrohrplantagen der Karibik und Lateinamerikas, überwiegend in Brasilien. Nordamerika war mit seinen Baumwoll- und Tabakplantagen „also keineswegs ein zentrales Ziel der Sklavenhändler“ (S. 52), wie oft fälschlich angenommen.
Im Zuge der transatlantischen Verschleppung, die einen bis heute diskutierten «Aderlass» des afrikanischen Kontinents bedeutete, konstituierten sich anthropologische Vorstellungen von «Rasse», wobei gegenüber den hellhäutigen europäischen Seeleuten, den «Weißen», aus den «Afrikanern» rassistisch als inferior eingestufte «Neger» wurden. Dieses kolonialistische Stigma wirkt bis heute nach.
Eckart greift das Bild der Sklavenplantage als das eines „traditionslosen Kombinationsexperiments [auf], bei dem Amerika den Produktionsfaktor Boden, Europa Startkapital und Ordnungsmacht und Afrika die Arbeitskräfte bereitstellte» (sensu J. Osterhammel, vgl. Eckert S. 56). Exemplarisch für Brasilien, die Karibik und Nordamerika werden die Brüche in der neuen Lebensweise der Versklavten beschrieben. Die „unterschiedliche ethnische «Clusterbildung» sowie das jeweils mitgebrachte spezifische kulturelle Gepäck“ führte in der Neuen Welt zur „Herausbildung distinkter Kulturen“ (S. 57). Eckert widerlegt das Vorurteil, die afrikanischen Sklaven hätten sich im „Zustand «kultureller Verwüstung» befunden, als sie in den Amerikas ankamen“ (S. 57), und verweist aus historischer, ethnosoziologischer und demographischer Perspektive auf ihre positiven Beiträge zu den transatlantischen Kulturen und Gesellschaften.
Von Abolition und Emanzipation handelt ein höchst aufschlussreiches Kapitel, das die Dynamik der Befreiung beschreibt. Es geht u.a. um die erfolgreiche Sklavenrebellion von 1791/92 auf Saint-Domingue, dem heutigen Haiti, die die Handlungsmacht der Sklaven belegt. In einem faktenreichen Diskurs werden die ambivalenten philosophischen Einstellungen zur Sklaverei von Montesquieu (1689–1755) über David Hume (1711–1776) und Kant (1724–1804) bis Hegel (1770–1831) skizziert und die engagierte Antisklavereibewegung von Parlamentariern wie dem Briten William Wilberforce (1759–1833) und weiteren Evangelikalen dargelegt. Entgegen häufiger Behauptungen waren die Aufklärung und selbst noch das 19. Jahrhundert „keinesfalls ein Zeitalter der Abolition, sondern im Gegenteil eine Periode, in welcher der Handel mit Menschen weiterhin boomte“ (S. 84), was der Autor anhand der Dissertation Capitalism and Slavery (1944) des aus Trinidad stammenden Oxford-Absolventen Eric E. Williams (1911– 1981) reflektiert.
Profund beschreibt der Afrika-Experte Eckert den «langsamen Tod der Sklaverei in Afrika» und den Weg ehemaliger Kolonien in die Prekarität, bevor er in einem leider etwas knappen Schlusskapitel zeigt, dass Sklaverei längst nicht allein ein Phänomen der Vergangenheit ist. Das erhebliche Ausmaß gegenwärtiger illegaler Ausbeutung in einer Grauzone zwischen sklavischer Zwangsarbeit und ausbeuterischen freieren Arbeitsverhältnissen wird vielfach verdrängt und verleugnet. Grob geschätzt leben heute über 40 Mill. Menschen, mehrheitlich Frauen und Kinder, in «moderner Sklaverei», u.a. Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, Leibeigenschaft, Zwangsprostitution und Menschenhandel. Schätzungen für Europa belaufen sich allein auf 560 000! Die 2013 in den USA gegründete transnationale Black Lives Matter-Bewegung leitete die längst überfällige Wende des «langen Schattens der Sklaverei» ein. Sie wendet sich gegen „strukturellen Rassismus, Polizeigewalt und Diskriminierung von Afroamerikanern“, gegen die Marginalisierung und Stigmatisierung von Nachfahren der Zwangsmigranten. In seinem Abschlussplädoyer sieht Eckert es als «Gebot der Stunde», „den Finger in die Wunde eines langen Vergessens und Verschweigens“ zu legen und sich kontinuierlich mit den bis heute erhaltenen Spuren der Sklaverei „in diversen Praktiken, Ideologien, sozialen und wirtschaftlichen Hierarchien und Monumenten“ (S. 111) auseinanderzusetzen.
Fazit: Das klar strukturierte, inhaltsreiche Sachbuch vermittelt einen souveränen wissenschaftlichen Überblick über die globalhistorischen Aspekte der Sklaverei. Für Dozenten und Studienanfänger einschlägiger Kulturwissenschaften eignet es sich als hervorragendes Kompendium, zumal es umfangreiche Literaturempfehlungen und hilfreiche Register enthält, und für historisch und politisch interessierte Laien ist es eine höchst empfehlenswerte anspruchsvolle Wissenslektüre. (wh)
Wolfgang Wissler, Kolumbus, der entsorgte Entdecker . Das Desaster des legendären Seefahrers. S. Hirzel Verlag, Stuttgart, 2021, 192 S., geb., ISBN 978-3-7776-2916-2, € 22,00.
Das hier vorliegende Buch von Wolfgang Wissler (*1960), Politredakteur beim Konstanzer SÜDKURIER, schreibt Geschichte auf ganz eigene Weise neu. Man kann den Band über Kolumbus (1451–1506) als »literarisches Sachbuch« oder »historischen Roman« rubrizieren, Buchgenres, die im Spannungsfeld zwischen historischer Wahrheit und Fiktion liegen. Dass es sich bei dem Band um keine Lobeshymne auf den »Großadmiral des Ozeanischen Meeres« handelt, verrät der Titel; und dass Kolumbus im Auftrag der spanischen Krone eine westliche Seeroute nach Indien und China suchte und dabei in der Karibik landete, deren Eilande er irrtümlich für die Westindischen Inseln hielt, weiß schon jedes Kind. Der Spannung der Erzählung tut das aber keinen Abbruch. Wisslers Geschichte setzt erst im Februar 1504 ein; da ist Kolumbus‘ Ruhm bereits angekratzt. Zwei Jahre zuvor war der einst gefeierte Held mit vier Karavellen in Cádiz in See gestochen. Diesmal, auf seiner vierten Reise, hatte er unzweifelhaft mittelamerikanisches Festland erreicht. Auf der Rückfahrt geriet die Flotte in Seenot. Kolumbus strandete mit zwei Schiffen auf der Insel Chaymaka (Jamaica). Dort hockt er frustriert auf dem Oberdeck der Capitania unter dem Sonnenschutz einer schäbigen Hütte. Das Wrack ist vom Holzbohrwurm (Teredeo navalis) (nicht Holzwurm!) zerfressen. Die erwartete Hilfe ist längst überfällig. Kolumbus’ Blick schweift über den ekelig schmutzigen Strand mit einer einzigen, versauten Latrine für 60 gestrandete Seemänner. Sollte nicht bald Rettung kommen, ist eine Meuterei nicht mehr aufzuhalten. Und immer die bange Frage: Wird der Palisadenzaun aus Bootsplanken vor möglichen Angriffen der Inselbewohner schützen? „Bisher war das Verhältnis zu den Indianern der Insel … ja, wie gewesen? Freundschaftlich?
Freundlich? Nein, wir wollen es nicht übertreiben. Geschäftlich vielleicht?“ (S. 13). Zu Anfang wurden die Schiffbrüchigen von den »Indianern« für ein paar Glasperlen und Tand fürstlich mit Nahrung versorgt, aber bald „hatten [diese] ihre Lektion in Wirtschaftswissenschaften gelernt und erkannt, dass die Gestrandeten sie viel mehr brauchten als andersrum“ (S. 13). Ohne die Hilfe der Einheimischen waren sie auf „stinkende Baumratten an Garnichts als Nachtmahl“ (S. 7f.) angewiesen.
Bereits vor hundert Tagen war Diego Méndez (1472– 1536), der Tapferste von Kolumbus’ Männern, zu zweit im Kanu nach Hispaniola (heute Haiti u. Dominikanische Republik) aufgebrochen, um Hilfe zu holen. Das sehnsüchtige Warten auf die Schiffe des Gouverneurs Nicolás de Ovando (1454–1511) wird zur Qual. Kolumbus’ ist unter Zeitdruck: „Er muss liefern. Er muss endlich Gold liefern. »Euer Dank ist Gold«, hat der König ihm einst gesagt“ (S. 31). Es drängt! „Wer weiß schon, was die Meuterer auf der Insel anrichten werden. Vermutlich ziehen sie durch die Wälder wie von der Kette gelassene Bluthunde, hungrig, geil nach Weibern und Gewalt“ (S. 12). – So geht Weltgeschichte bei Wissler!
In XIII Kapiteln öffnen sich durch ständig wechselnde Szenen mit mal pfiffigen, mal nachdenklichen oder auch ungehobelten Dialogen und Monologen immer neue Fenster in die Vergangenheit. Den überraschenden Raum- und Zeitsprüngen vermag der Leser kaum zu folgen. Gerade noch versucht Kolumbus manipulativ die „kleinmütige Gefolgschaft bei Laune zu halten“ (S. 9), da läuft er Gefahr, dass sie ihm „vielleicht vor lauter Langeweile die Haut [abziehen]“ (S. 11); dann fällt sein Blick zurück in die Zeit von 1493, als er, „der Zugewanderte, der Ausdauernde, der Sturkopf“ (S. 14), es mit seiner Entdeckung allen gelehrten Zweiflern gezeigt hatte, als selbst die spanischen Majestäten sich vor ihm erhoben.
In »Mitarbeitergesprächen«, wie Wissler sie spöttisch nennt, muss Kolumbus seinen Seeleuten immer wieder Hoffnung auf Rettung machen, das nervt ihn. Dabei wollte er immer nur wissen, was „es hinter dem Horizont Ungeheueres, Geheimnisvolles zu entdecken gibt“. Und „jetzt ist alles so kompliziert“ (S. 36).
Große Teile des Buches handeln von der Konkurrenz zwischen Kolumbus und Amerigo Vespucci (1454–1512), den Wissler als intriganten, trickreichen Blender zeichnet, nach offiziellen Quellen unzulässig überzeichnet; aus dramaturgischen Gründen verständlich. Schließlich ist Vespuccis Ruf in der Historie umstritten. So ist unklar, ob er vier oder nur zwei Expeditionen an die Ostküste Südamerikas unternahm. Im Gegensatz zu Kolumbus, den er als »Ochse ohne Vorstellungskraft« schmäht, ist Vespucci sich sicher, eine Neue Welt entdeckt zu haben.
In einer skurrilen Episode bekennt der Florentiner, dass er „nicht gerne [reist], und schon gar nicht über Wasser“. Aber „wenn man als großer Entdecker gelten will, muss man sich gelegentlich in diesen sagenhaften neuen Ländern, in dem sogenannten Indien blicken lassen“ (S. 38). Zu den gelungenen Kapiteln gehört Vespuccis Aufwartung beim Gouverneur von Hispaniola. Es gilt „aus der Entdeckung etwas Ordentliches zu machen, etwas was Bestand hat, auf das man aufbauen kann, das Nutzen bringt“ (S. 43). Erst nach Tagen kommen Gespräche zustande, in denen sich der trinkfreudige, als Regierungschef überforderte Ovando besäuft und seine Geringschätzung gegenüber Kolumbus, dem „Emporkömmling. Ausländer. Spinner. Chaot, Bankrotteur“ (S. 49) herausbrüllt. Für den verschlagenen Vespucci ist es ein Leichtes, Ovandos Vertrauen zu gewinnen und von Kolumbus’ Desaster zu erfahren. Das ist „die Gelegenheit, die Komplikation Kolumbus ein für allemal zu erledigen“ (S. 56), den Widersacher zu »entsorgen«. Vespucci ist euphorisiert von dem Gedanken, fragt aber zuvor den eingekerkerten »Kanusportler« Mendéz, ob Gold gefunden wurde. Vergebens, denn Mendéz durchschaut ihn und verrät seinen Kommandanten nicht. Auf Vespuccis eitle Frage, ob Kolumbus wirklich nie von ihm gesprochen habe, antwortet Mendéz: »Niemals«. »Niemals«. Welch eine Demütigung! – Damit war entschieden, das keine Hilfe aus Hispaniola kommen würde, − sollten sie doch verhungern oder von den Eingeborenen umgebracht werden!
Historisch ist belegt, dass es unter Anführung von Francesco des Porras (c. 1574–?) zur Meuterei kam, die Kolumbus mit wenigen zu ihm haltenden Seeleuten überlebte. Als diese 1504 von Mendéz auf eigene Faust mit einer Karavelle gerettet wurden, da ist Kolumbus schon „klein, krank, gebrochen, verstaubt. Unbedeutend und verloren“ (S. 186). Die Meuterei mit dem Schlachtruf »Nach Kastilien!« und das blutige Gemetzel an den Inselbewohnern, die gezwungen werden, die Meuterer in ihren Kanus in die Heimat zu bringen, wird plastisch geschildert. Welch irrsinniger, zum Scheitern verurteilter Versuch, der in einem wilden Massaker endet. Wie dramatisch der Terror auch erzählt wird, die Tragik für die Insulaner und die sich anbahnende historische Katastrophe des Zusammenpralls der Kulturen ist unbeschreiblich, unfassbar.
Solange Wisslers Erzählung aufgrund historischer Quellen im Bereich des Möglichen liegt, entwickelt sie beachtliche Kraft. Das gilt für ausgefeilte Dialoge zwischen Ovando, Mendéz und Vespucci. Anrührend ist das Gespräch zwischen Kolumbus und seinem betrübten Schiffsjungen Tejo, der prophetisch klagt: »Ich glaube, dass wir alles Schlechte herbringen. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht richtig ausdrücken kann, Herr« (S. 143), und erklärt: »Ich meine bloß, dass sie nichts von uns lernen können. Dass wir ihr Leben nur verschlechtern werden […]« (S. 144). Wenn Kolumbus den Jungen tröstet: »Es werden bessere Menschen folgen. Wir sind ja bloß die Vorhut […]« (S. 144), und wirsch beruhigend hinzufügt, dass er ja nur will, dass das Land Spanien gehört, verharmlost er bewusst die wahren Ziele der Eroberung, denn bereits in den Verhandlungen mit dem fiktiven „verantwortungsbewussten“ (S. 21) Kaziken Ameyro zeigt sich, wie die »Weißhäutigen« durch überlegene Waffen und verlogenen Tauschhandel die »Indianer« ausbeuteten und zerstörerisch in das labile Gefüge der dauerverfeindeten indigenen Großsippen eingriffen, die sich, wie Wissler salopp formuliert, „nicht die Ananasscheibe auf dem Brot gönn[en]“ (S. 21).
So weit so gut. Aber seinen literarischen Sachbuchcharakter verliert das Buch spätestens, als der »Unberührbare« ins Spiel kommt und der Boden der historischen Tatsachen vollends verlassen wird. Wissler greift „das üble Gerücht“ von dem einzigen Überlebenden eines Schiffbruchs auf, der auf Madeira oder Porto Santo von Kolumbus gepflegt wurde. Dabei entlockte er dem sog. »Lotsen« Kunde von der Neuen Welt. Nach der Legende kreuzte Kolumbus zusammen mit seinem Freund Gabriel in einem entwendeten kleinen Schiff dessen Vaters 1476 den Atlantik. Während Gabriel in der Karibik blieb, kehrte Kolumbus allein zurück, um anschließend im Auftrag Spaniens zum eigenen Ruhm die Neue Welt „ein zweites Mal [zu] entdecken, „[s]ozusagen offiziell, mit Brief und Siegel“ (S. 126) Sie ahnen es vermutlich schon – ausgerechnet seinen Jugendfreund Gabriel, den »Unberührbaren«, trifft Kolumbus auf Chaymaka wieder. Die Begegnung mit dem gelähmten Freund, der im Stamm Aymeros von Menica, einer indigenen Frau, liebevoll umsorgt wird, kann man als raffinierten literarischen Schachzug sehen, um in Rückblenden über Kolumbus’ Jugend, Tatendrang und Abenteuer zu berichten. Wenn aber in den Erinnerungen der Freunde das Bild des »Edlen Wilden«, das romantische Ideal des von der Zivilisation unverdorbenen Naturmenschen, fröhliche Urständ feiert, fällt die moralisierende Darstellung in längst überholte Menschenbilder der Romantik à la J.-J. Rousseau zurück und missachtet sträflich moderne wissenschaftliche Erkenntnisse der Historie, Anthropologie, Ethnologie und Soziologie, für die Sachbücher des Traditionsverlags Hirzel doch eigentlich stehen. Fazit: Der Debütroman des Journalisten Wissler weist Licht und Schatten auf. Für mich wiegen allzu wilde Fiktionen und insbesondere anthropologisch-ethnologische Mängel schwer. So sag ich’s mal in Gadamers Worten: „Man muss wissen, wann man Dinge, die zur Kenntnis gebracht werden, nicht zur Kenntnis nimmt.“ (Habermas in Figal 2000, S. 54). (wh)
Prof. Dr. Dr. h.c. Winfried Henke (wh) war bis 2010 Akadem. Direktor am Institut für Anthropologie, Fachbereich 10 (Biologie), der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Er ist Mitglied der Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften und der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin.
henkew@uni-mainz.de