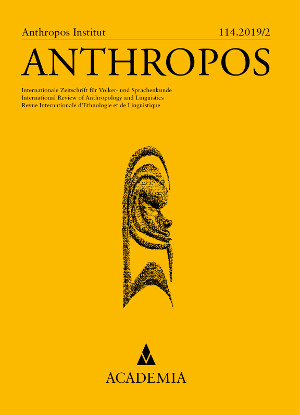H. Glenn Penny: Im Schatten Humboldts. Eine tragische Geschichte der deutschen Ethnologie. Aus dem Englischen von Martin Richter, C.H. Beck Verlag, München 2019, Gebunden, 287 S., 37 s/w-Abb., ISBN 978-3-406-74128-9, € 26,95
Als H. Glenn Penny, Professor für Moderne europäische Geschichte an der Universität Iowa, 2017 als Fellow an das Wissenschaftskolleg zu Berlin kam, schwebte dem Spezialisten für die Beziehungen zwischen Deutschland und nichteuropäischen Kulturen ursprünglich ein Projekt zu Fragen von Diaspora und Emigration vor. Aber die kontroverse Diskussion, die seit Jahren vor dem historischen Hintergrund von Kosmopolitismus, Kolonialismus und Ethnologie über das im Bau befindliche Humboldt-Forum geführt wird, kippte sein Vorhaben. Stattdessen schrieb der amerikanische Historiker auf Drängen seines deutschen Bekanntenkreises Eine tragische Geschichte der deutschen Ethnologie für ein „allgemeines Publikum […], um an solchen Debatten am besten teilzunehmen“ (S. 271). In fünf faktenreichen Kapiteln berichtet Penny, wie es durch den imperialistischen Ausbau überseeischer Kolonial reiche und die damit einhergehende rasante Expansion des Welthandels gleichzeitig zu einer intensiven Steigerung des allgemeinen und wissenschaftlichen Interesses an außereuropäischen Völkern und ihren Kulturartefakten kommt. Im Nachgang zu den Entdeckungsreisen von Alexander v. Humboldt konstituieren sich wissenschaftliche Gesellschaften für Anthropologie und Ethnologie, gefolgt von der Errichtung zahlreicher Völkerkunde-Museen und schließlich auch universitärer Völkerkunde-Institute. Ging es in den Wunderkammern und Kuriositätenkabinetten des 18. und frühen 19. Jahrhunderts um die Zurschaustellung ‚exotischer Dinge‘, um die Faszination des ‚Fremden‘ für ein feudales Publikum und wohlhabende Bürger, so zielten die entstehenden Museen auf die Präsentation ethnografischer Sammlungen „…zum Zweck, den Wachstumsprozess eines geistigen Organismus, wie in den Denkschöpfungen des Menschengeschlechts auf dem Erdplaneten emporgeblüht, in den Thatsachen anschaulicher Verkörperungen vor Augen zu führen“ (lt. Führer des Museums für Völkerkunde, Berlin 1887; s. Penny S. 89). Im Mittelpunkt der vorliegenden wissenschaftshistorischen Abhandlung steht zunächst die Biografie des Initiators der Völkerkunde/Ethnologie in Deutschland, Adolf Bastian (1826–1905). Der Gründungsdirektor des Berliner Museums für Völkerkunde hatte Medizin bei Rudolf Virchow (1821–1902) studiert und war als vermögender Bremer Kaufmannssohn und Privatgelehrter zeitlebens auf weltweiten Forschungsreisen, auf denen er zunächst durch Diskussionen, Beobachtungen und Texte unzählige Informationen sammelte. Da er aber auch mit schriftlosen Ethnien zusammentraf, „wandte Bastian sich bald der Analyse und Sammlung der materiellen Kultur zu – alles, was Menschen produzieren und benutzen, von ihren großen Monumenten und höchsten Kunstwerken bis zu den einfachsten Handwerksarten und Alltagsgegenständen“ (S. 17). Penny zeigt, wie das Sammeln von Ursprüngen (Kap. 1) immer exzessivere Formen annahm, denn Bastian war ein ‚Seelenfischer‘, der die Menschen, denen er begegnete, für sein Projekt der Erfassung der ‚Elementargedanken‘ begeistern konnte. Darunter verstand er jene Grundstrukturen menschlicher Vorstellungs- und Handlungsmuster, die sich bei dem Schweizer Psychiater C.G. Jung (1875–1939) als ‚Archetypen‘ wiederfinden.
Neben vielseitig ausgebildeten Mitarbeitern wie u.a. Felix von Luschan (1854–1924), dem späteren ersten Lehrstuhlinhaber für Anthropologie in Berlin, und Karl von den Steinen (1855–1929), der später Ordinarius für Völkerkunde in Marburg wurde, fand Bastian auch viele ausländische Helfer zur Realisierung seiner Pläne für ein «universales Archiv der Menschheit», darunter den norwegischen Kapitän Johan Adrian Jacobsen (1853–1947). Der autodidaktische Ethnologe akquirierte durch trickreichen Handel auch Objekte für das Hamburger Völkerkunde-Museum und warb für Hagenbecks ethisch umstrittene Völkerschauen. Bastians „Sammelinteresse [wurde] rasch zu einer Obses sion mit Gegenständen“ (S. 49), entwickelte sich zu einem Hypersammeln (Kap. 2), denn ihm war bewusst, dass sein Zeitalter eines des Sammelns war, das nicht ewig dauern konnte. Und so lautete sein Mantra: «Rettet! rettet! ehe es zu spät ist» (Gedächtnisrede 1905, K. von den Steinen; zit. Penny, S. 68).
Bastians Vision einer «Lesehalle für das inductive Studium der Wissenschaft vom Menschen» (S. 66) endete im Chaos. Die Sammlung platzte infolge des Erwerbs deutscher Kolonien und der Ausweitung des Welthandels aus allen Nähten, zumal der Bundesrat Ende 1880 die Resolution erließ, „alle in den Kolonien gesammelten Objekte seien zunächst nach Berlin zu schicken“ (S. 103). Aufteilungen der Sammlungen, so die einhellige Meinung, würden dem Zweck der Sammlung zuwiderlaufen. Der Vorschlag einer Trennung der Sammlung zwischen Kultur- und Naturvölkern, wurde vehement abgelehnt, «weil das Studium grade der Übergänge ein Hauptproblem der Ethnologie bildet» (S. 107). Als schließlich der Kunsthistoriker Wilhelm von Bode 1906/7 Direktor der Königlichen Museen wurde, siechte das Berliner Völkerkundemuseum kurz nach dem Tod von Adolf Bastian völlig dahin, seine große Vision wurde untergraben – dauerhaft, und wirft heute kritische Fragen zur Provenienz und Restitution auf. An den für die afrikanische Kunst völlig einzigartigen Benin-Bronzen exemplifiziert Penny die Kolonialismus fragen (Kap. 3). 1897 waren die Kunstobjekte durch eine Strafexpedition der britischen Regierung am Königreich Benin als Kriegsbeute in die Hände englischer Marineinfan teristen gelangt, die sie „an fast jeden, Kapitäne, aufgeweckte Händler, [verkauften], sogar Leihäuser in London kauften und verkauften sie im Lauf der ersten Wochen“ (S. 114). Felix von Luschan erfuhr diese «ganz curiose Sache» und organisierte mithilfe von Mäzenen durch geschicktes Feilschen und Intrigieren die Rettung der Bronzen «für die Wissenschaft» (S. 123). In seinem Hauptwerk von 1919 über die Artefakte von Benin untergrub Luschan „koloniale Ideologien, die auf biologischen Rassenlehren beruhten!“ (S. 127). Wie sein Mentor Rudolf Virchow widerlegte er öffentlich die ‚Rassenkunde‘ als Pseudowissenschaft. Im Band Völker Rassen Sprachen von 1922 betonte Luschan: «Die trennenden Eigenschaften der sog. ‹Rassen› sind im wesentlichen durch klimatische, soziale und andere Faktoren der Umwelt entstanden» (Penny S. 129). Es sprach sich offen dafür aus, andere Völker als Menschen gleicher Würde zu respektieren, wozu Erkenntnisse der Ethnologie beitragen würden.
Penny findet Luschans antirassistische Positionen bewundernswert, verhehlt aber auch nicht komplexe Widersprüche, wenn er fragt, ob seine heldenhaften Rettungstaten in unseren Narrativen über deutsche Geschichte seine „Teufelspakte“ im Namen der Wissenschaft legitimieren? (vgl. S. 130). Denn Luschan war auch Arzt und physischer Anthropologe, der u.a. eine große Schädelsammlung anlegte, wofür er „eifrig Kolonialtruppen zum Sammeln von Knochen und besonders von Schädeln ein[spannte]“ (S. 131), u.a. im Herero-Krieg und dem nachfolgenden Völkermord in Deutsch-Südafrika (1904–1907). Er war ein Imperialist, der die deutschen Kolonialtruppen für ihren Beitrag zur Völkerkunde lobte und den Verlust der Kolonien bedauerte, da damit seine Vorstellung eines Kolonialmuseums zerbrach. Belastend kommt hinzu, dass er in seinem Spätwerk „auch einige Elemente des darwinistischen Nationalismus und der Eugenik (Rassenhygiene) [übernahm]“ (S. 132), zu Zeiten, in denen u.a. durch Untersuchungen des Mediziners und Anthropologen Eugen Fischer (1874–1969) an den sog. «Rehobother Bastards», die deutsche «Rassenkunde» gesellschaftlich bereits mehr und mehr Raum griff. In der Zeit nach dem 1. Weltkrieg setzen führende Ethnologen trotz des Verlusts der Kolonien die Sammeltätigkeit in den transnationalen Netzwerken, die Bastian geschaffen hatte, fort. Am Beispiel von Franz Termer (1894–1968), der von 1935 bis 1965 Direktor des Museums für Völkerkunde in Hamburg war, zeigt Penny, wie der Altamerikanist in Mittelamerika das globale Sammelnetzwerk der Auslandsdeutschen weiterführte, indem er bestehende „Konnexe“ ausbaute und somit über Generationen gesammeltes Material für die Völkerkunde „rettete“! (Kap. 4). Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten „bewegte er sich in zwei einander überschneidenden Welten“ (S. 187), zwischen überzeugten
Gegnern und strammen NSDAP-Mitgliedern. Wie viele Völkerkundler war er kein Gegner des Nationalsozialismus, und deshalb klingt es wie Hohn, wenn er in einer Rede von 1946 beklagt, „die Deutschen seien die er sten Opfer des Nationalsozialismus gewesen“ (S. 232). Aber diese Art von Selbstmitleid zieht sich durch die Biografien vieler Ethnologen und Anthropologen, die nach dem 2. Weltkrieg bald wieder in die wissenschaftliche Gemeinschaft aufgenommen wurden. Die Vergangenheitsbewältigung zahlreicher Protagonisten geriet zur Farce, wie Penny u.a. am Beispiel von Hans Plischke (1890–1970; Göttingen), Otto Reche (1879–1966, Leipzig) und Wilhelm R. Mühlmann (1904–1988; Berlin, Heidelberg) zeigt, − eine Liste, die mühelos fortgesetzt werden könnte. In Kap. 4 mit dem vielsagenden Titel Die Vergangenheit in der Zukunft wird beschrieben, wie ab 1934, lange vor dem Krieg, in den Völkerkundemuseen mit der Sicherung der Artefakte begonnen wurde; man verbrachte die ethnografischen Objekte in Bunker, Bergwerksstollen und an andere vermeintlich sichere Orte. Vieles wurde zerstört, ging verloren oder wurde von sowjetischen Trophäenbrigaden an sich gebracht, bevor Alliierte nach Kulturgütern suchten. Penny beschreibt, wie die Sowjetbehörden zu Zeiten der DDR zahlreiche Objekte an das Leipziger Grassi Museum zurückgaben, die nach der deutschen Wiedervereinigung nach Berlin zurückkehrten. Viele Stücke blieben verschwunden oder hatten gelitten und mussten aufwendig restauriert werden. Und heute, wo die Chance besteht, im Humboldt Forum endlich Museen als das zu sehen, was sie sind, „moderne Schatzhäuser, Gefäße, die große Teile der Menschheit in die Gegenwart getragen haben“ (S. 242), stellt Penny in seinem Epilog die Frage „Was ist zu tun?“ (S. 261). Um die tragische Geschichte des Berliner Museums endlich zu überwinden und einen Teil von Bastians Vision eines «Laboratoriums» der Menschheitsgeschichte zu realisieren, sollte das Humboldt-Forum keine „weitere Schausammlung mit einer Espressobar“ (S. 286) werden, denn schon 1886 forderte der Museumsführer lautstark, „das Potenzial der Sammlungen und ihren Nutzen für eine umfassende vergleichende Analyse zu erkennen“ (S. 265). Das Schlusskapitel gerät zu einer Philippika gegen das Konzept der Museumsplaner, das – wie schon das von Bode – große Teile des Fundus in die Depots verbannt, und mit ausgewählten Exponaten versucht wird, „eine willkürliche Geschichte als logischen Prozess darzustellen“ (S. 258). Es geht Penny – wie Bastian – um die „Macht von Objekten“, darum, „dass Präsentation, Wissen, Forschung und Wissenschaft nicht getrennt werden sollten“ (S. 265), während für das Schlossprojekt der kosmopolitische Ruf der Brüder Humboldt und ihr Bildungsideal als Zugpferd dienen (vgl. S. 257). Pennys Kritik stimmt in den Vorwurf der politischen Instrumentalisierung des 600.000 Euro teuren Gebäudes ein. Für viele Kritiker ist die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit primär, aber für Penny ist Restitution nur ein Teilproblem, denn «Rückgabe [ist] ein verworrenes Gewerbe» (Penny, S. 267 nach Chip Colwells). Im Mittelpunkt seiner Vorstellungen steht die Förderung intensiver Kooperation mit indigenen Gruppen, „um das Füllhorn von Erinnerungen und Wissen, eingebunden in die materiellen Äußerungen von Weltanschauen“ (S. 247) zu erschließen. Aber werden da nicht längst offene Türen eingerannt (siehe https://www.preussischer-kulturbesitz.de/ newsroom/dossiers-und-nachrichten/)? Was Pennys Über legungen bzgl. der Möglichkeit der Realisierung visionärer Projekte in Deutschland betrifft, so hätte ich mir etwas mehr Realitätssinn für die Grenzen unseres Bildungswesens und eine Orientierung an den diversen aktuellen Fragestellungen der Ethnologie gewünscht (vgl. FBJ 3/2019: 74-76). Für jene, die mit der Wissenschaftsgeschichte wenig vertraut sind, liefert Penny durch die Würdigung von Ethnologen/Anthropologen des 19. Jahrhunderts eine Entlastung vom Vorwurf des Kolonialismus und damit einen wichtigen Beitrag zur Versachlichung der hitzigen Debatte um Raubkunst und Restitution. Aber die problematischen Verstrickungen zahlreicher Fachvertreter der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rechtfertigen keine Entlastung nach dem Motto, man habe doch nur im Interesse der Wissenschaft nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Wer mitdiskutieren will, sollte Pennys aufschlussreiches und streitbares Buch in dem Bewusstsein lesen, dass es „eine Geschichte“ der Ethnologie ist, eben seine. (wh) ●
Prof. Dr. Dr. h.c. Winfried Henke (wh) war bis 2010 Akadem. Direktor am Institut für Anthropologie, Fachbereich 10 (Biologie) der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Er ist Mitglied der Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften und der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin.
henkew@uni-mainz.de