August Sander schrieb 1931 in seinem Vortrag Wesen und Werden der Photographie: „Da der Einzelmensch keine Zeitgeschichte macht, wohl aber den Ausdruck seiner Zeit prägt und seine Gesinnung ausdrückt, ist es möglich, ein physiognomisches Zeitbild einer ganzen Generation zu erfassen und zum Ausdruck im Photo zu bringen.“1 Im Oktober sind zwei Fotobücher erschienen, die jeweils ein Zeitbild einer ganzen Generation in Fotografien zum Ausdruck bringen. Der eine Fotograf war noch nie in New York, der andere hat 30 Jahre dort gelebt. Das eine Buch erzählt von einer einzigen Nacht, die 30 Jahre zurückliegt, in zufälligen Porträts. Das andere ist eine Sammlung Auftragsarbeiten, Porträts, die über 30 Jahre hinweg entstanden sind.
Andreas Rost zeigt in 3. Oktober 90 Porträts aus der Nacht vom 3. Oktober 1990. Rost hatte die Nacht am Brandenburger Tor und Reichstag verbracht und die Wiedervereinigungsfeier beobachtet. Die dort entstandenen Fotografien lagen nun 30 Jahre in einer vergessenen Kiste, bis Rost sie 2020 wiederentdeckte. Das Buch ist eine Tour de Force durch ein System, das im Moment des Fotografierens feierlich zu Grabe getragen wurde. Ashkan Sahihi hat in den 1980er und 1990er Jahren die Kunstszene New Yorks fotografiert. The New York Years beschreibt eine Zeit in Porträts der kreativen Klasse, von u.a. Louise Bourgeois, Siri Hustvedt, Willem Dafoe, Paul Auster. Es ist ein kontemplatives Flanieren durch eine Stadt, die sich als „Koalition der Verrückten“ verstand und heute von ebendiesen nicht mehr bezahlbar ist. Von Gemeinsamkeiten lässt sich auf den ersten Blick nicht sprechen.
Dennoch entsteht in der Auseinandersetzung mit den beiden Büchern der Eindruck, dass diesen beiden Archivarbeiten eine ähnliche Haltung zugrunde liegt und beide Fotografen auf sehr unterschiedliche Weise vergleichbare Hintergründe haben. Es sind Welten, die es so nicht mehr gibt, und dennoch will sich kein Gefühl der Nostalgie einstellen, sondern eines der Neugier, wer sowohl die Menschen vor als auch hinter der Kamera sind, wer sie waren, wo sie herkamen, wo sie hinwollten, wo sie heute sind. Da sich in beiden Fällen das Narrativ auch nicht auf eine Dimension festnageln lassen möchte, entsteht eine Unsicherheit, in welcher Welt man sich befindet und ob man so viel über die Vergangenheit weiß, wie man angenommen hatte. Zwei Fotografen, die sich bisher nicht begegnet sind – ein Gespräch.
Kristina Frick, geboren 1980 in Wiesbaden, ist Fotografin, Autorin und Übersetzerin und lebt in Berlin. kristina.frick@gmx.de
Ashkan Sahihi, The New York Years, Distanz Verlag, 2020, 224 S., 103 Farb- und 112 s/w-Abb., Softcover, ISBN 978-3-95476-338-2, € 42,00. Eine begleitende Ausstellung zu The New York Years ist noch bis Ende 2020 in der McLaughlin Galerie in Berlin zu sehen.
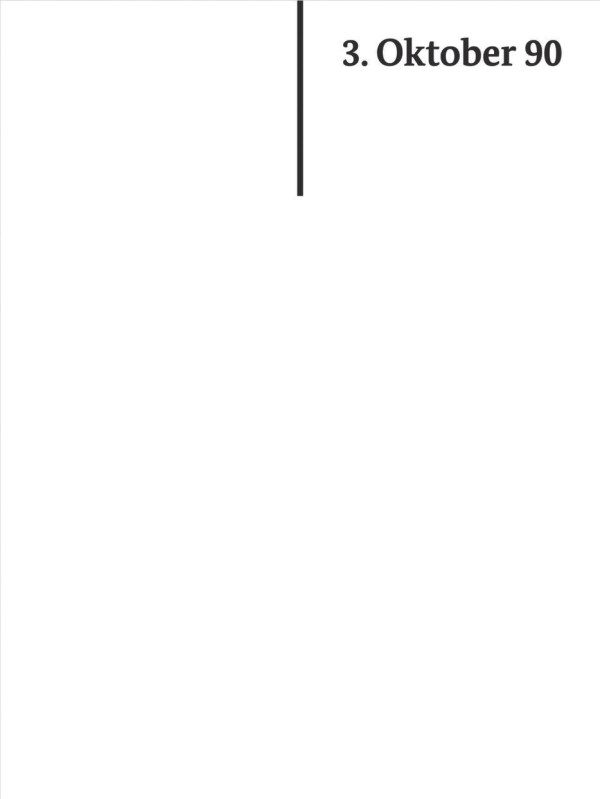
Andreas Rost, 3. Oktober 90, Wasmuth Verlag, 2020, 116 S., Klappenbroschur, ISBN 978-3-8030-3412-0, € 24,80. Begleitbuch zur Ausstellung „Wiedervereinigung“ im Dresdner Kupferstichkabinett.

Ashkan Sahihi, 1963 in Teheran geboren. Mit sieben Jahren kam Sahihi nach Deutschland, zwischen 1987 und 2014 lebte und arbeitete er in New York, seit 2014 in Berlin. Er fotografierte für Magazine wie das Zeitmagazin, Spiegel, New York Times Magazine, Vogue. Im Jahr 2000 wurde seine Arbeit in der Andrea Rosen Gallery in New York vorgestellt, es folgten Einzel- und Gruppenausstellungen im MoMA PS1, in der Akademie der Künste Berlin und im Macro in Rom.

Andreas Rost, 1966 in Weimar geboren, schloss 1993 sein Fotografie-Studium bei Arno Fischer und Evelyn Richter an der HGB in Leipzig ab. Seitdem arbeitet er als Fotograf sowie als Dozent für nationale und internationale Institutionen in Berlin. 1990 war er Mitbegründer des Kunsthauses Tacheles. Seit 2001 ist er als Kurator tätig, u.a. für c/o Berlin, das Goethe Institut und das Institut für Auslandsbeziehungen.
Es gibt Parallelen, gemeinsame Themen: die Stadt im Wandel der Zeit, das Archiv, die Verortung der eigenen Realität in der Peripherie.
Sahihi: Ich glaube, die Art zu fotografieren, hat etwas gemeinsam. Es mag sein, dass es nicht sofort auf der Hand liegt, wenn man diese beiden Arbeiten vergleicht, aber auch da gibt es etwas Gemeinsames. Ich glaube, wir haben beide Respekt vor unseren Mitmenschen. Das sehe ich in Andreas’ Arbeiten, und ich bewundere sie nicht nur sehr, sondern deswegen mag ich sie auch sehr. Ich glaube, eine Vorgehensweise, die wir teilen – und es tut mir leid, wenn ich den Satz nicht 100 % richtig zitiere – aber ich glaube, Andreas hat mal gesagt, dass er sich für die Geschichte hinter der Geschichte interessiert, und ich glaube, da kann man auch sagen, dass man sich für das Gesicht hinter dem Gesicht interessiert. Er hat es in einem sehr aufgeregten Moment der Masse geschafft hat, das Individuum, das Gefühl, die Stille umzusetzen. Das ist ein sehr echtes und gemeinsames Interesse. Ich beanspruche das für mich. Ob es mir so gut gelingt wie Andreas, weiß ich nicht, aber es ist etwas, das mich interessiert.
Gemeinsam habt ihr auch, dass ihr nach 30 Jahren euer Archiv wiederentdeckt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht habt.
Rost: Es ist ganz merkwürdig mit den 30 Jahren Abstand. Fotografie hat immer etwas mit Vergangenheit zu tun. Wir wissen in dem Moment, wenn wir auslösen, dass das, was zu sehen ist, schon Vergangenheit ist. Aber diese Vergangenheit berührt mich merkwürdig mit diesem Blick von heute. Wir haben Corona, wir haben diese merkwürdige Wahl in den USA, wir haben diese merkwürdigen Feierlichkeiten zu 30 Jahren Wiedervereinigung, die durch Corona auch nicht stattgefunden haben. Auf der anderen Seite, wenn ich die Bilder von Ashkan sehe, und auch meine, erinnere ich mich immer an den Titel von Stefan Zweig Die Welt von Gestern. Ich habe das Gefühl, dass in diesen beiden Arbeiten an eine Welt erinnert wird, die in diesem Moment gerade untergeht. Das ist eine Interpretation von heute, aber dennoch stellt sich beim Betrachten dieser Bilder eine Melancholie ein. Die Protagonisten von Ashkan waren wichtige Leute aus der New Yorker Kunstszene, die aber vor 30 Jahren ganz anders organisiert war. Mit meinem Blick von außen als eine sehr solidarische, avantgardistische, freiheitsliebende Gesellschaft wahrgenommen.
Sahihi: Andreas, korrigiere mich, wenn ich dich falsch zitiere, aber ich meine, du hast gesagt: „Wenn man als Fotograf lange genug still steht, sehen die Leute einen irgendwann nicht mehr und man kann ein tolles Bild machen.“ Darf ich das so sagen?
Rost: So ungefähr habe ich es auch gesagt.
Sahihi: Ich glaube daran und ich meine das ernst. Trotz der Unterschiedlichkeit der beiden Arbeiten gibt es die Ähnlichkeit. Ich konnte natürlich bei Irvine Welsh oder Dennis Hopper nicht so lange rumstehen, dass ich unsichtbar wurde – aber ich glaube schon, dass es um ein Ruhig-Bleiben, ein Interessiert-Bleiben, ein Betrachter-Sein geht. Wir sind in einem Beruf, in dem viele Leute sich der Selbstdarstellung hingeben und glauben, ein Rockstar zu sein. Ich wollte nie ein Rockstar sein. Ich wollte wissen, wie Rockstars sind, was ihre Geheimnisse sind, warum sie sind wie sie sind, was sie antreibt. Um das zu erfahren, musste ich mich zurücknehmen, dass sie Freiraum haben. Deswegen empfinde ich diese Verbundenheit zu Andreas‘ Arbeiten und sehe die Ähnlichkeit. Ich glaube, dass er sich auch rausnimmt, und das ist eine Geheimwaffe.
Ein anderer Punkt ist die Zeit. Die Zeit, die sich geändert hat. Ich weiß nicht, ob du den Begriff genannt hast, aber der Begriff der Nostalgie – für mich ist das Faszinierende, dass ich diese Arbeit sehr gerne machen wollte. Sie hat ja 30 Jahre lang im Lager gelegen und ich habe sie nicht für interessant genug empfunden, sie anzugehen. Mit der Arbeit wäre nichts passiert bis Freunde begannen, zu drängeln und sogar sagten, dass sie den Transport bezahlen, damit ich das endlich angehe. Mir war sehr wichtig, dass es kein nostalgisches Ding wird. Ich finde, Andreas hat völlig recht: Es ist jetzt doppelt nostalgisch geworden. Es ist nicht nur aus einer Zeit, die es nicht mehr gibt, sondern es ist auch noch aus einer Zeit vor einer Pandemie. Wir alle empfinden im Moment Nostalgie für Dinge. Auf einmal hat es bei uns beiden etwas von einer Zeit, die es nicht mehr gibt.
Eine Nostalgie, die die Vergangenheit nicht glorifiziert?
Rost: Es geht bei der Nostalgie gar nicht so sehr darum, ob früher alles besser oder alles schlechter war. Vielleicht ist es besser, wenn man das nicht mit Zeit bezeichnet, sondern mit Welt. Dass es diese Welt bald nicht mehr geben wird. Das heißt ja, dass sich die Bezugssysteme gerade ändern. Das, was heute wertig ist, war früher noch gar nicht erahnbar. Andererseits steckt in den Fotos natürlich auch die Vorbereitung auf das, was es heute gibt. Man sieht in meinen Fotos diesen kommenden Populismus à la Trump, AfD. Bei Ashkan sieht man die Leute, die damals schon wach gewesen sind, so etwas zu sehen und zu beobachten.
Wenn die Arbeiten nur nostalgisch wären, wären sie uninteressant. Sie ragen in die heutige Zeit hinein und werden zu Symbolen.
Sahihi: Es war ein großer Vorteil, den wir Älteren, die analog fotografiert haben, hatten. Es gab das „Zeig mal“ nicht. Das war für die Porträtarbeit sehr beruhigend. Es hat der Sache ein Nicht-Wissen gegeben, die Suche intensiver gemacht. Du musstest für dich entscheiden, wann du das Bild hattest, das du wolltest.
Rost: Ashkan, das ist interessant, und da ist meine Frage an dich: Wenn du dir heute deine Kontaktbögen und Negative anguckst, wählst du dieselben Bilder aus wie vor 30 Jahren oder hast du heute eine andere Auswahl getroffen?
Sahihi: Dieselben Bilder. Das war irgendwie ein tolles Gefühl, denn ich habe seitdem schon zwischen fünf und 30 Jahren mehr Bilder gemacht und angesehen. Es ist ein schönes Gefühl, dieselben Bilder ausgewählt zu haben.
Rost: Ich merke heute, dass ich andere Bilder aussuche und dass ich heute in meiner Auswahl der Bilder nicht mehr so streng bin. Ich lasse auch Bilder zu, die kleine Fehler haben. Mir ist die Geschichte, die in dem Bild steckt, wichtiger, und bei diesem ganzen digitalen Kram hat man ganz schnell die Bilder gelöscht, von denen man in dem Moment, kurz nach dem Aufnehmen, glaubte, sie wären fehlerhaft. Man könnte den Film wegschmeißen, aber man löscht nicht einzelne Bilder, worüber ich sehr froh bin, weil mir so die vermeintlichen Fehler erhalten bleiben.
Sahihi: Es gibt eine Textstelle, da erzählst du, dass du ganz viel gearbeitet hast, um dir endlich eine Kamera leisten zu können, die du schon ganz lange haben wolltest. Ich bin wirklich kein Tech Head, aber was war das denn für eine Kamera?
Rost: Das ist Geschichte. Wollt ihr die Geschichte hören? Ich war politisch sehr aktiv, Runder Tisch, Opposition und so. Dann sehr schnell frustriert, weil ich merkte, dass ich als Ossi nicht durchkomme. Heute denke ich, manches, was wir gesagt haben, war gar nicht so blöd. Ich habe nicht für ein politisches Amt kandidiert, sondern mein Studium fortgesetzt. Aber ich wollte nicht mehr in der Stadt bleiben, in der ich studiert habe. Also habe ich mir einen Lehrer genommen, der in Berlin in seinem Wohnzimmer unterrichtet hat. Dann musste ich mir natürlich auch eine neue Aufgabe in Berlin suchen. Die war, das Tacheles2 zu besetzen. Dann wollte ich da fotografieren. Nun war mein Lehrer Arno Fischer3. Wenndu einen Lehrer hast, der auch noch ein so ausgezeichneter Fotograf ist, hast du ein Problem. Ich wollte natürlich alles anders machen. Ich wollte im Tacheles fotografieren und ich wollte das nicht mit einer Leica machen, wie Arno. Ich wollte Porträts machen wie August Sander4. Dazu brauchte ich mindestens eine Mittelformatkamera. Also musste ich mir diese Kamera irgendwie besorgen, was natürlich schwierig war, weil ich kein Geld hatte. Also habe ich im Sommer nebenbei gearbeitet und konnte mir Ende des Sommers die Kamera kaufen. Das war eine Mamiya 645, Rollfilm, 4,5×6. Nun hatte ich also diese Kamera, Ende September, und es gab zwei große Events, die ich hätte fotografieren können. Das erste war die Einweihung des ersten Berliner Technoclubs, der war damals im Tacheles, die Ständige Vertretung. Aber da durfte man nicht fotografieren. Das andere war die Wiedervereinigung. Gut, darfst du im Tacheles nicht fotografieren, gehst du eben zur Wiedervereinigung. Letztlich kann man sagen, das war ein Kameratest.
Sahihi: Eine andere ganz große Gemeinsamkeit ist August Sander. Ich habe zwar die meiste Zeit meines Lebens in New York gelebt, aber die Schuljahre von der ersten bis zur 13. Klasse habe ich in Deutschland verbracht und ich bin viel eher von Bauhaus, Sander und europäischen und russischen Fotografen und Cinematographen geprägt als von Amerikanern. Die Frage, wie August Sander das gemacht hätte, schwang und schwingt immer extrem mit. Ich erinnere mich, dass ich das in einem Interview mit Andreas gelesen habe und dachte: „Genau.“ Ob das eine Frage der Generation, der Zeit, ist, der Welt, die es nicht gibt, weiß ich nicht. Ich werde von amerikanischen Fotointeressierten immer gefragt, ob das ein Diane Arbus5 Ding sei. Aber nein, es ist eher ein August Sander Ding. Ich glaube, das war eine andere Art von Neugier.
Rost: Ein großer Unterschied – ich bin noch nie in New York gewesen, noch nie in den Staaten. Selbst, wenn ich hinfahren würde, hätte ich eine unendliche Hemmung, vielleicht würde ich sogar ohne Kamera hinfahren, weil ich nicht wüsste, was ich in New York machen sollte. All die großen Fotografen, von denen wir im Studium erfahren haben – Robert Frank, Lee Friedländer, Diane Arbus – was zum Teufel sollte Andreas Rost in New York fotografieren? Ich stelle mir das schrecklich vor. Ashkan hat etwas sehr Schlaues gemacht, er hat Leute fotografiert, vielleicht auch mit August Sander im Hinterkopf, aber nicht New York. Aber irgendwann hast du wahrscheinlich festgestellt, dass das sehr wohl New York ist, als du genügend Leute fotografiert hattest.
Sahihi: Ja. Ich bin damals in ein New York gezogen, das den Ruf hatte, dass man dort machen kann, was man machen will. Ich wollte wissen, was diese Magie ist. Warum es eine so unglaubliche Menge an immens talentierten Menschen gab. Es stimmt, ich habe das noch nie so gesehen, aber genau das hat mich interessiert. Diese Beschaffenheit, die sich aus meiner Sicht aus Leuten zusammengesetzt hat. Jedes Mal, wenn man etwas gesehen hat, das einen beeindruckt hat, kam das aus New York.
Eine geistige Heimat zu schaffen, ein Gefühl der Dazugehörigkeit, bzw. der Wille, nicht Teil dieses Systems zu sein. Ist das etwas, was euch angetrieben hat, was man in Städten wie Berlin und New York finden konnte?
Sahihi: Es war sogar eine Rettung. Die Geschichte meines Lebens ist ja, dass ich nirgendwo dazugehöre. Ich bin Perser, aber dadurch, dass wir nicht Moslems sind, waren wir Außenseiter. Ich habe nicht dazugehört. Dann kamen wir nach Deutschland. Mir ist nichts passiert, niemand hat mich bedroht, aber ich war jahrelang der dunkelste im Jahrgang. Ich sah immer anders aus und habe auch da nicht dazugehört. Auf jeden Fall war New York für mich auf einmal ein Ort, wo ich zum ersten Mal ein Gefühl der Dazugehörigkeit empfunden habe. Weil das eine Koalition der Aussätzigen, Durchgeknallten und Verrückten war. I belonged.
Rost: Ich glaube, ich kann von mir sagen, ich hab‘ mich in diesem Land, in das ich hineingeboren wurde, auch nie zugehörig gefühlt. Ich war immer Außenseiter. Aber mein Außenseitertum war anders als das von Ashkan, weil er so aussieht, wie er aussieht. Unglaublich toll, im Übrigen. Mein Außenseitertum war ein Stück weit freiwillig gewählt, denn ich sehe so aus wie jeder Deutsche. Aber durch mein Punksein, durch meine Haltung, durch meine Auffassung, gehörte ich nicht dazu. Auch in den 1990ern hatte ich das Gefühl, nicht dazuzugehören. Es gab eigentlich nur ein kurzes Gefühl, als ich dachte, das ist meine Welt, das ist meine Heimat, das war dieser merkwürdige Oktober, November, Dezember ’89, als wir etwas bewegen konnten.
In dem Moment, in dem man hinter eine große Kamera tritt, distanziert man sich auch intensiv von der Geschichte, die man da fotografiert, und das war auch bei der Wiedervereinigungsfeier so. Man steht außen vor, man betrachtet es. Man ist anwesend, aber nicht involviert. Das bekommt dann etwas Soziologisches, fast Wissenschaftliches. Das war möglicherweise für mich durchaus wichtig, diese Distanz herzustellen, um den Kummer und den Schmerz loszuwerden. Insofern gibt es da vielleicht emotionale Unterschiede, auch wenn unsere Arbeitsmethoden sich sehr ähnlich sind.
Sahihi: Die Parallele ist, sich die Aufgabe des Beobachtens zuzugestehen. Das war immer eine Möglichkeit, dabei zu sein und zu behaupten, man dokumentiert nur. Das ist eine merkwürdige Kombination aus extremem Privileg und Unsichtbarkeit.
Rost: Weil wir heute so oft August Sander hatten: Der Leitspruch seiner Arbeit war „Sehen, Beobachten, Denken.“ Das ist genau dieser Moment.
Man ist da, aber man ist nicht involviert. Ich bin ja nicht am Protestieren, sondern ich bin am Fotografieren. Ein Großteil meiner Aufnahmen sind Demonstrationen und Massenveranstaltungen, und ich kann eines von mir sagen: Als Ossis mussten wir immer demonstrieren und ich hasse es. Ich habe immer versucht, mich zu drücken und da nicht hinzugehen, um dann den Rest meines Lebens Demonstrationen zu fotografieren. Das ist auch ein bisschen bekloppt.
Sahihi: Fotografierst du gerne?
Rost: Ja, wahnsinnig gerne. Ich bin in gewisser Weise schon auch ein Technik-Narzisst. Wenn ich eine schöne Kamera habe, eine Leica in der Hand zu halten ist einfach auch ein gutes Gefühl. Wenn ich irgendwo hinkomme und mir fällt nichts ein, hole ich erst die Kamera raus, spiele an der rum, stelle was ein und gucke durch, dann komme ich ganz automatisch zum Fotografieren. Im Moment fotografiere ich sehr viel analog, mit einer 4×5 Inch oder 8×10 Inch. Old fashioned.
Sahihi: Keine Frage, das ist was anderes. Die Übung, das Sich-vertrauen-Müssen, ein Gefühl herzustellen, wann man das Bild geschossen hat, das war spannend. Aber ich finde es auch sehr anstrengend zu fotografieren. Man lernt ja Menschen kennen und will es richtig machen. Das ist schon eine sehr spannende Dynamik. Oder auch von der Aufnahme wegzugehen mit dem Gefühl „Das war nichts“, das Gefühl von Enttäuschung, so dass man dann an seinem Selbstwertgefühl rummacht.
Rost: Dann kriegst du die Bilder wieder oder entwickelst sie selbst und stellst fest, dass doch was drauf ist. Das ist wie Weihnachten.
Wenn man mit dem Selbstwertgefühl zu kämpfen hatte und die Arbeiten dann 30 Jahre später noch einmal betrachtet, fragt man sich dann: Warum hast du dich damals so verrückt gemacht?
Sahihi: Deswegen halten die Sachen auch stand, denn the struggle is real. Diese Fragen: Muss es das beste Foto werden, das ich je gemacht habe? Kann ich mich auf diese Person einlassen? Bringe ich sie dazu, sich auf mich einzulassen? Kriegt man das hin? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich bin sehr dankbar, dass das Zeug meinem eigenen Auge standhält. Es hätte auch sein können, dass wir das alles rüberholen und ich sitze dann drei Wochen vor sieben staubigen Kisten und denke „Konditor hättest du werden sollen“.
Das Wichtigste ist, dass es dem eigenen Auge standhält, denn man selbst ist ja der härteste Kritiker.
Rost: Das ist schon ein bisschen absurd. Im Moment denke ich wirklich – und das ist kurz vor Größenwahn – dass ich neben Michael Schmidts6 Buch „Einheit“ vielleicht das wichtigste Buch zur deutschen Wiedervereinigung gemacht habe. So arrogant bin ich. Aber noch vor fünf Jahren hätte ich so etwas nie gesagt und ich hätte immer gedacht „Das ist alles Schrott und interessiert keine Sau“.

Mit freundlicher Genehmigung von MCLAUGHLIN.
Sahihi: Bei dir war es tatsächlich ein Zufall, dass dir dieses Paket mit Filmen wieder in die Hand fiel?
Rost: Das war ein totaler Zufall. Ich hatte das fast vergessen und ich hatte es ja auch unter Kameratest verbucht. Ein Museum wollte Fotos vom Tacheles haben, deswegen musste ich an die Ordner. Dort lag so ein Packen, auf dem stand „Wiedervereinigung.“ Dann habe ich mir die Lupe genommen und habe geguckt, ob das wirklich die Wiedervereinigung ist. Die hatten alle so Buttons, auf denen stand 3. Oktober 90. Da war mir klar, das ist die Wiedervereinigung. Dadurch, dass ich mir das mit der Lupe angesehen habe, habe ich eben viele Begebenheiten am Rand entdeckt, die mich zu diesen extremen Ausschnitten geführt haben. So habe ich das gezeigt, was ich eigentlich gar nicht fotografieren wollte. Ich wollte ja eigentlich nur die Porträts machen. Das war natürlich klar, dass bei so einer Massenveranstaltung ständig jemand ins Bild rennt oder irgendwas passiert. Das war gar nicht so sehr mein Wunsch, es ließ sich nur nicht vermeiden. Heute denke ich: Zum Glück sind die mir ins Bild reingerannt.
Fungieren die Ausschnitte als eine Art Kommentar?
Rost: Das denken immer alle Leute, dass ich mir etwas dabei gedacht habe. Aber in Wahrheit würde ich sagen: Zwischen ein und vier Uhr morgens, eine Flasche Rotwein und nicht mehr so ganz munter, da habe ich Ausschnitte gemacht und irgendwie montiert. Was ich damit sagen will, ist, das folgt keinem rationalen, soziologischen, wissenschaftlichem Programm. Das ist mehr eine Intuition, was zusammen passt und was nicht. Was passiert, wenn die Bilder nebeneinander stehen, sprechen die miteinander oder nicht? Ich bin kein konzeptionell arbeitender Künstler, auch wenn es jetzt so aussieht. Das war wirklich reine Intuition.
Es ist für mich eher wie Musik, in diesem Fall eher wie Punk. Es gibt keine logische Erklärung.
Es muss kein Konzept oder soziologische Beobachtung zugrunde liegen, aber du hast dich entschieden, dass die Leute alle nach oben gucken.
Rost: Das ist auch so eine von den vielen Geschichten. Warum gucken die nach oben? Ganz logisch, die standen vor dem Reichstag. Im Reichstag fand die Party der politischen Führung statt. Ab und zu gingen unsere Anführer mal auf den Balkon und winkten dem unten stehenden Volk zu, was dazu führte, dass das unten stehende Volk immer nach oben guckte. Das ist die ganz einfache Erklärung. Im Nachhinein ist die Erklärung natürlich völlig unwichtig, denn in gewisser Weise sind das ja fast religiöse Bilder mit einer Heilandserwartung.

An dem Tag ist ein Bild entstanden, da bin ich drauf. Das hat Jochen Sandig vom Radialsystem, damals Geschäftsführer vom Tacheles, fotografiert. Ich stand vor dem Reichstag und habe fotografiert, Jochen stand mit der Regierung im Reichstag. Er erzählte die schöne Geschichte, dass Helmut Kohl Lothar de Maizière bat, auch mal auf den Balkon zu gehen, aber de Maizière wollte eigentlich nicht, und der war ja auch in der Bevölkerung nicht beliebt. Dann ging er doch raus, auf den Balkon, und die Masse brüllt auf, schreit, applaudiert. De Maizière geht wieder rein, zu seiner Tochter, die stand bei Jochen Sandig, und sagte „Die waren glücklich, dass sie mich gesehen haben, die haben applaudiert“. Was de Maizière nicht gesehen hat, war, dass in dem Moment, in dem er auf den Balkon ging, jemand unter dem Balkon die Fassade hochkletterte. Die Leute haben dem Fassadenkletterer applaudiert.
So ist das auch mit meinen Bildern. Die wahre Ursache, warum die nach oben gucken, ist für die Bilder uninteressant. Interessant ist der Ausdruck, der in den Blicken steckt, nämlich diese Heilserwartung. Ashkan, wenn du Porträts machst, gehst du mit einem festen Plan rein? Gerade bei dem Paul Auster Bild, das ich so liebe, ist ja im porträttechnischen Sinne fast alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Trotzdem ein geniales Bild.
Sahihi: Nein, überhaupt nicht. Die große Ausnahme ist Irvine Welsh, da habe ich diesen komischen Flohkragen mitgenommen und habe ihn gefragt, ob er das mitmacht. Ich denke immer, das sind so interessante Leute, wenn man sich auf sie einlässt, wird es schon interessant werden.
Rost: Du gehst in der Situation voll auf?
Sahihi: Schön gesagt, ja. Wenn es klappt, fühlt es sich ja so ein bisschen an, als würde man sich verlieben. Das war das schönste Gefühl, wenn so ein Begegnungsmoment da war und man sich traute, etwas zu sagen. Als ich Paul Auster fotografiert habe, war er ja in Deutschland schon ein Star, in den Staaten nicht. Die Europäer haben ihn viel früher entdeckt, in Deutschland war er schon bei Fischer. Ich war schon sehr gespannt, ihn kennenzulernen. Ich war 24, und dass ich mit 24 auf die Idee kam, zu Paul Auster zu sagen, er solle sich aufs Bett legen, einen Basketball unter dem Kopf, dann solle er rauchen und wie ein wahrer, französischer Existenzialist an die Decke gucken, das war schon was. Im Nachhinein denke ich, nicht schlecht für 24. Ich glaube, ich gehe eher rein mit dem Gedanken „Hoffentlich klappt es, hoffentlich mögen sie mich“. Ich würde es gar nicht wagen, mir vorher ein Konzept zurechtzulegen. Wahrscheinlich auch, weil wir diese Generation sind, die diese konzeptionellen Fotos, Annie Leibovitz7 zum Beispiel, so peinlich fand. Ich fand die so langweilig und die wurde in den 1980ern hoch und runter gefeiert. Aber genau darum geht es doch in der Fotografie nicht.
Wer war denn für dich ein Negativ-Beispiel? So mache ich das nicht?
Rost: Die waren für mich nicht wichtig und ich habe mich auch nie damit auseinandergesetzt. Ich hatte eben Arno Fischer und konnte mir nicht vorstellen, dass man mit einer anderen Haltung an die Fotografie treten würde als Arno Fischer oder Evelyn Richter. Das war für mich ausgeschlossen. Es gibt ja schon große Fotografen, was mich aber eigentlich nicht interessiert. Dieter Appelt finde ich großartig, aber ich könnte das nie machen. Oder selbst die Bechers finde ich großartig, aber ich bin viel zu faul, um so etwas zu machen. Ich würde sterben vor Langeweile, wenn ich jetzt ein Leben lang Wassertürme fotografieren würde. Sie haben ein großartiges Werk geschaffen, aber es ist eine Haltung, die nichts für mich ist.
Mir gefällt das ja, dass dir August Sander gefällt. In Deutschland ist Sander der große Soziologe. Wenn August Sander Soziologe gewesen wäre, wären die Fotos komplett langweilig. Das sind Porträts, die sprechen. Wenn ich mir den Soldaten von 1944 angucke, den Blick in die Kamera, dann weiß ich, dass er weiß, dass der Krieg verloren ist. Wenn das nicht mehr wäre als Soziologie, dann wäre das nicht so großartig, wie es ist.
Sahihi: Sander war der Stern, an dem sich Die Berlinerin8 orientierte. Diese Arbeit ist ganz klar an seine angelehnt, mit allem, was sich verändert hat, mit allem, was jetzt anders ist. Aber bei der Berlinerin ging es genau darum, ob man eine Stadt über sich selbst erzählen lassen kann. Ein Gewebe aus Porträts erzählt etwas über sich, und auch hier ging es darum, wie weit man sich zurücknehmen kann. Zu jeder Aufnahme alleine zu gehen, keine Assistenten, kein Blitz, es sei denn, der war erwünscht. Eine ganz einfache Kamera mitzunehmen. Die Berlinerin ist der große Liebesbeweis an August Sander.
Rost: Lustig ist ja, dass ein richtiger Soziologe sagen würde, dass schon die Kategorien von Sander gar nicht stimmen, nicht funktionieren. Die Frau, das ist doch keine soziologische Kategorie. Es ist natürlich wunderbar, ein Buch zu machen, Die Berlinerin und erzählen zu lassen. Der New Yorker Geschichte ist das nicht ganz unähnlich. Man fotografiert Frauen und man fotografiert Persönlichkeiten. Man fotografiert immer einzelne Menschen, aber wenn man sie dann nebeneinander hat, ist es doch wieder Berlin.
Ich war auch 24, als ich diese Bilder gemacht habe. Mit 24 hat man anderen Größenwahn. Das Konzept war von jung bis alt, arm bis reich, Ost bis West. Also möglichst viele verschiedene Menschen zu fotografieren, wie sie auf die Wiedervereinigung reagieren. Was in gewisser Weise ein August Sander-Konzept ist. August Sander in einer Nacht ist ein Ausdruck von Größenwahn. Das würde ich mich heute leider nicht mehr trauen.
Sahihi: Es ist eine Anlehnung an einen Meister, dem man das Meistersein zugesteht. Ich verstehe, was du meinst. Ich komme immer wieder an die gleiche Geschichte. In der Nacht, als Barack Obama gewählt wurde, wurde unser damaliger, erster und einziger schwarzer Bürgermeister – der er damals schon nicht mehr war – David Dinkins gefragt, ob Obama ohne ihn möglich gewesen wäre. Er meinte nur „We all stand on each other’s shoulders“. Ich verstehe das, wenn du sagst, es hat was von Größenwahn. Aber es sind ja eher die Leute, die einen geprägt haben. Würde man so tun, als hätten sie einen nicht geprägt, würde man so tun, als wüsste man nicht, dass man auf deren Schultern steht und ihnen etwas schuldig ist, dann wäre das problematisch.
Was ein Ding, dass deine Bilder auch 30 Jahre rumlagen. Du hast es zufällig gefunden, ich hab‘ Druck gemacht bekommen. Eineinhalb Jahre hat eine Person auf mich eingeredet. Jetzt ist die Zeit, jetzt sind wir in dem Alter, in dem wir uns umdrehen, umschauen und auf unsere Jugend schauen und wissen wollen, was war damals eigentlich. Er meinte, in fünf Jahren interessiert sich keiner mehr dafür. Dann haben wir Enkelkinder und müssen uns mit falschen Hüftgelenken rumschlagen, dann interessiert das keinen Menschen mehr. Ich habe mich geweigert, dann hat er mir die Pistole auf die Brust gesetzt und den Transport bezahlt. Dieses Weigern, sich wehren, dass du es in die Ecke gepfeffert hast, weil es Testrollen waren, und ich sagte, es interessiert keinen Menschen, das ist das Pendant zum Fassadenkletterer. Ein ganz anderes Bild als dann wirklich erscheint.
Rost: Bei mir war es komplizierter, weil ich auf der einen Seite sehr arrogant bin, auf der anderen sehr schüchtern. Arrogant bin ich bei Fotografie. Ich weiß ganz genau, was ich kann, worin ich gut bin. Ich weiß aber auch, was ich nicht kann. Bestimmte Sachen kann ich gar nicht. In der Fotografie bin ich sehr arrogant und sehr hart in meinem Urteil. Aber ich hätte das nie hingekriegt, Paul Auster zu besuchen und ihm zu sagen, was er machen soll. Ich finde, deine Haltung, zu sagen „Hoffentlich mag er mich“, ganz prima. Ich wäre eher davon ausgegangen, dass er mich nicht mag und mich zu dumm findet. Man hat eigentlich mindestens 25, fast 30 Jahre immer gesagt, dass diese Fotografie aus dem Osten Deutschlands nichts wert ist und irgendetwas Sozialdokumentarisches in SchwarzWeiß und ohne künstlerische Relevanz. Das führte dahin, dass ich selber zwar weiter fotografiert habe, aber irgendwann aufgehört habe, Sachen zu zeigen. Weil der Kunstmarkt und die Museumsdirektoren uns immer bedeutet haben, dass wir Schrott produzieren.
Sahihi: Vergleichbar mit dem Reifeprozess. Jetzt haben wir die Ruhe, uns umzudrehen und noch mal zu gucken.
Rost: Ja. Erstaunlicherweise fiel das mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zusammen, als andere Leute auch merkten, dass nicht alles doof war, was wir gemacht haben. Es ist sogar interessant und erklärt einiges. Es gibt gerade ein sehr intensives Interesse an Fotos aus dieser Zeit und an Erklärungen. Es war lange Zeit ein schwarzes Loch in dieser Gesellschaft und jetzt kommt es aus irgendwelchen Gründen hoch, die vielleicht auch etwas mit dieser untergehenden Welt zu tun haben.
Interessant ist, Ashkan muss aus Gründen aus dem Iran weg, wächst in Deutschland auf, geht aus Deutschland weg, nach New York, er ist überall Außenseiter. Auf eine andere Art und Weise, nicht so existenziell, bin ich ja auch immer Außenseiter gewesen. Das Merkwürdige an dem Außenseitertum ist, dass ich das sichere Gefühl habe, von den Rändern aus intensiver gucken zu können.
Sahihi: Ich bin ganz deiner Meinung. Es ist ein Privileg, keinen klassischen bürgerlichen Beruf auszuführen. Ich empfand das als Privileg, nicht tagtäglich die gleichen Dinge tun zu müssen und das ganze fünf oder sechs Mal die Woche. Es war ein Privileg, an verschiedenen Orten sein zu können, verschiedene Menschen kennenzulernen, zu reisen und mit anderen Leuten zu reden, die die Welt ganz anders sahen. Ich empfand es als meine Verantwortung, eine Geschichte zurückzubringen. Das Privileg war, du darfst raus, du darfst berichten, aber du musst eine Geschichte mitbringen. Ich habe mich gefunden in der Rolle des Außenstehenden. Dieser Austausch hat funktioniert. Ich musste nicht ein Leben leben, für das ich mich nicht als gemacht empfinde. Aber dafür erzähle ich, dafür zeige ich, was an anderen Orten passiert.
Ihr habt beide ein Format gewählt, das an ein Magazin erinnert.
Sahihi: In meinem Fall waren das alles Auftragsporträts. Deshalb war es mir sehr wichtig, nicht so zu tun, als sei ich irgendwie der Promifotograf, der ein riesiges Coffeetable Book macht. Deswegen das Originalformat des amerikanischen Fotopapiers. Außerdem haben wir die Originalabzüge gescannt, damit man nicht nur die Beschaffenheit von Film und Papier, das Charakteristische einfängt, sondern auch das, was Zeit und Umwelt den Drucken angetan haben. Deswegen auch das Softcover, weil ich mir wünsche, dass auch das Buch irgendwann Benutzungsspuren hat. Es ist ein Ding, das lebt.
Rost: Wir haben ja sogar eine Nut eingestanzt, dass man das Buch einreißen kann. Wenn auf meinem Grabstein stünde „Er war ein großer Künstler“, dann fände ich das okay. Mir persönlich wäre wichtiger, wenn auf meinem Grabstein stünde „Er war ein Fotograf“. Die Arbeit war so autonom, dass ich keine Rücksicht nehmen musste, und ich versuche, eine Form zu finden, die dem gegenwärtigen Zeitpunkt entspricht, wie ich über die Bilder denke. Es sollte wie eine Verlautbarung der Bundesregierung rüberkommen und nicht wie ein Buch von Lee Friedländer oder so. Es sollte kein Kunstprodukt werden, das Papier nicht zu edel, weil das dem Thema widerspräche. Die Ursprungsidee war: Folge den Bildern. Ich hatte nicht die Absicht, etwas anderes rüberzubringen als das, was in den Bildern steckt.
Sahihi: Meine Sorge war, dass es eine Nostalgienummer wird. Deshalb habe ich einen Trick angewandt und beschlossen, dass ich nicht mit jemandem in meinem Alter zusammenarbeite, nicht mit einem Mann. Ich habe beschlossen, mit einer jungen Grafikdesignerin zusammenzuarbeiten und mich rauszunehmen. Ich habe ihr 224 Bilder gegeben und sie zweieinhalb Monate in Ruhe gelassen, so dass sie tun konnte, was sie für richtig hielt. Hilka Dirks hat die Reihenfolge der Bilder zusammengestellt und die Typo ausgesucht. Sie hat die Futura ausgesucht und hat es sicherheitshalber noch einmal ihrem Professor gezeigt, der dann meinte, man könne diese Typo heutzutage nicht mehr benutzen, das gehe nicht. Ich habe ihr dann die Geschichte von Julian Schnabel9 erzählt. Als er an die Cooper
Union10 kam, wurde er gefragt, warum er denn Malerei studierte, Malerei sei doch tot. Er sagte, dann wäre es ja der perfekte Zeitpunkt, mit der Malerei anzufangen. Wenn also der Professor sagt, diese Typo könne man nicht benutzen, dann ist das genau die richtige Zeit, um sie zu benutzen. Das sind Momente bei der Arbeit gewesen, da hatte ich das Gefühl, wir bringen eine alte Sache in die Zukunft, dadurch dass es von einem neuen, jungen Blick bearbeitet wird. Spannend, wie das bei der nächsten Arbeit wird.
Das ist es in der Tat.
In spätestens 30 Jahren erwarten wir zwei neue Bücher. Wäre aber auch schön, wenn es vorher schon klappt.
Vielen Dank, Ashkan Sahihi und Andreas Rost, für dieses schöne und spannende Gespräch über Zoom, an einem späten Novemberabend und trotz CovidErkrankung.
1 August Sander, Wesen und Werden der Photographie. Die Photographie als Weltsprache, 5. Vortrag, Blatt 9 1931. Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archiv.
2 Das Tacheles war lange Jahre ein alternatives Kunst- und Kulturhaus in der Oranienburger Straße in BerlinMitte.
3 Deutscher Fotograf, 1927–2011.
4 Deutscher Fotograf, 1876–1964.
5 Amerikanische Fotografin, 1923–1971.
6 Deutscher Fotograf, 1945–2014.
7 Amerikanische Fotografin, *1949.
8 Ashkan Sahihi, Die Berlinerin, Distanz Verlag, 2015.
9 Amerikanischer Maler, *1951.
10 The Cooper Union for the Advancement of Science and Art ist ein privates College in Lower Manhattan, New York City.






